Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2020 verfasst von Fabio Schwabe, Mettmann. Die aktuelle Version stammt vom 14.09.2023. Fabio Schwabe ist Gymnasiallehrer der Fachrichtung Geschichte und Gründer von Geschichte kompakt
Die nächste Klausur steht an und das nächste Abitur kommt bestimmt? Mit unseren Lernmaterialien kannst du sofort starten und für dein Thema lernen. Zeig’s deinen LehrerInnen!
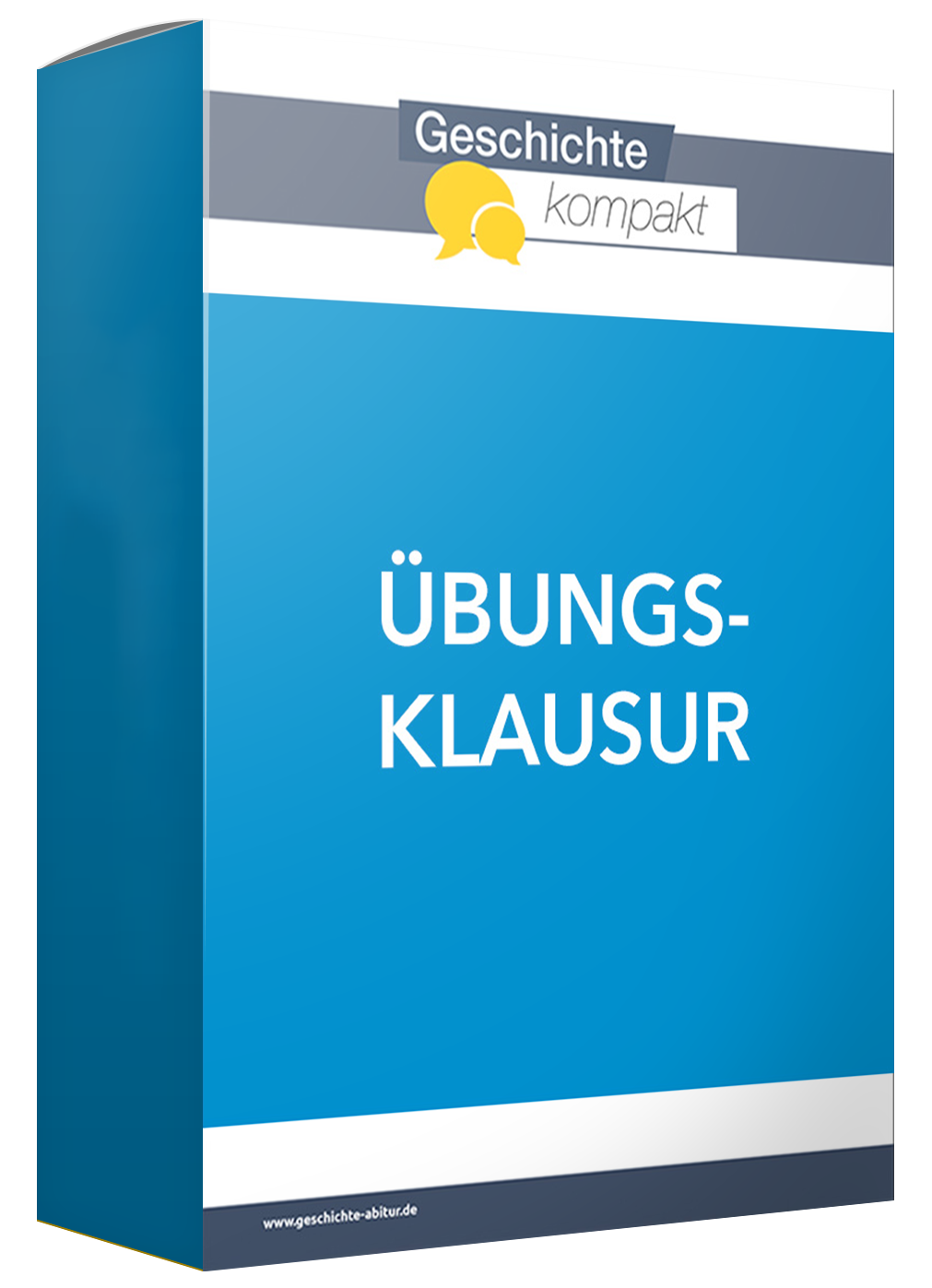
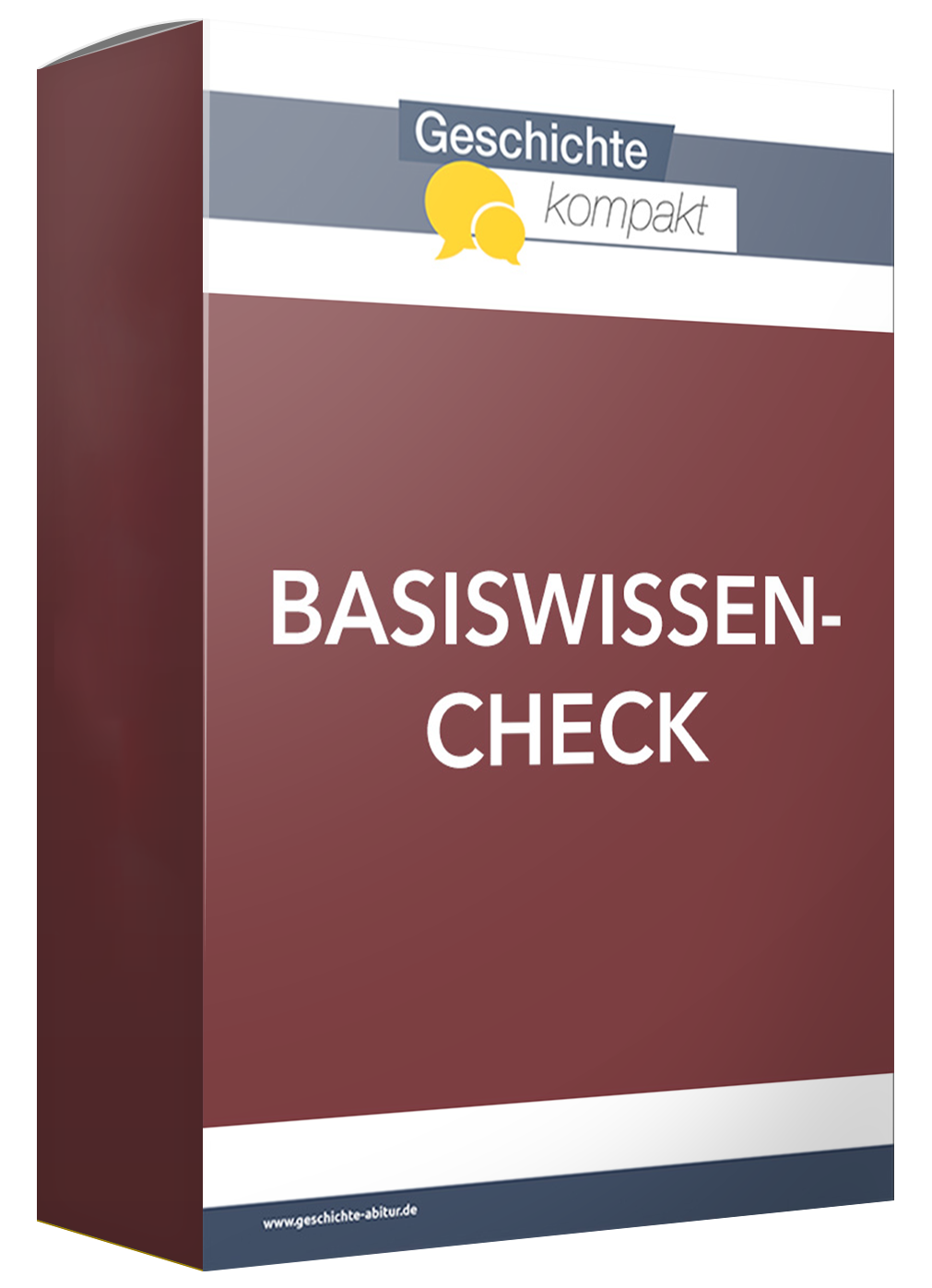
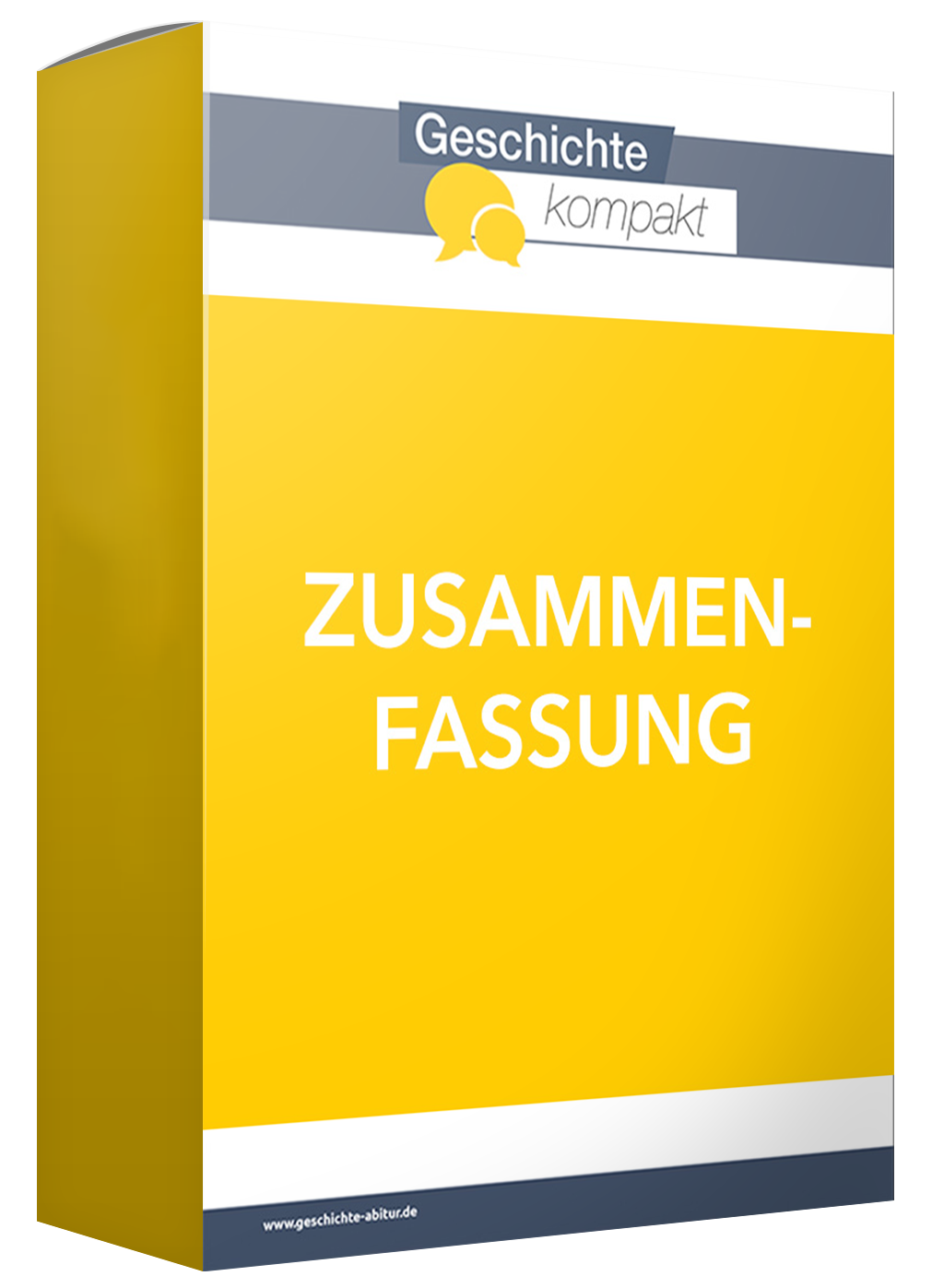
In unserem Lernshop bieten wir alle Lernmaterialien zu allen Themen auch in unserem Mega-Sparbundle an.
Geschichte kompakt ist eine Internetplattform, die vor allem Schülerinnen und Schülern das Lernen für das Unterrichtsfach Geschichte erleichtern soll. Sie bietet aber auch allen anderen Geschichtsfans die Möglichkeit, die wichtigsten Ereignisse der deutschen Vergangenheit einfach und schnell zu verstehen. Wir erklären Dir alle Themen einfach, kompakt und verständlich: Dann klappt’s auch garantiert mit der Klausurvorbereitung – und mit dem Abi sowieso.
© 2012 – 2024 | Geschichte kompakt. Mit Liebe gemacht in Mettmann, NRW.
Geschichte kompakt Nutzerfeedback - 4,9 / 5 aus 1892 positiven Bewertungen
Es sieht so aus, als hättest du keine Auswahl getroffen